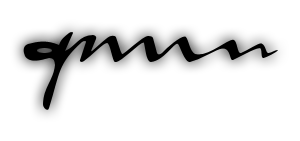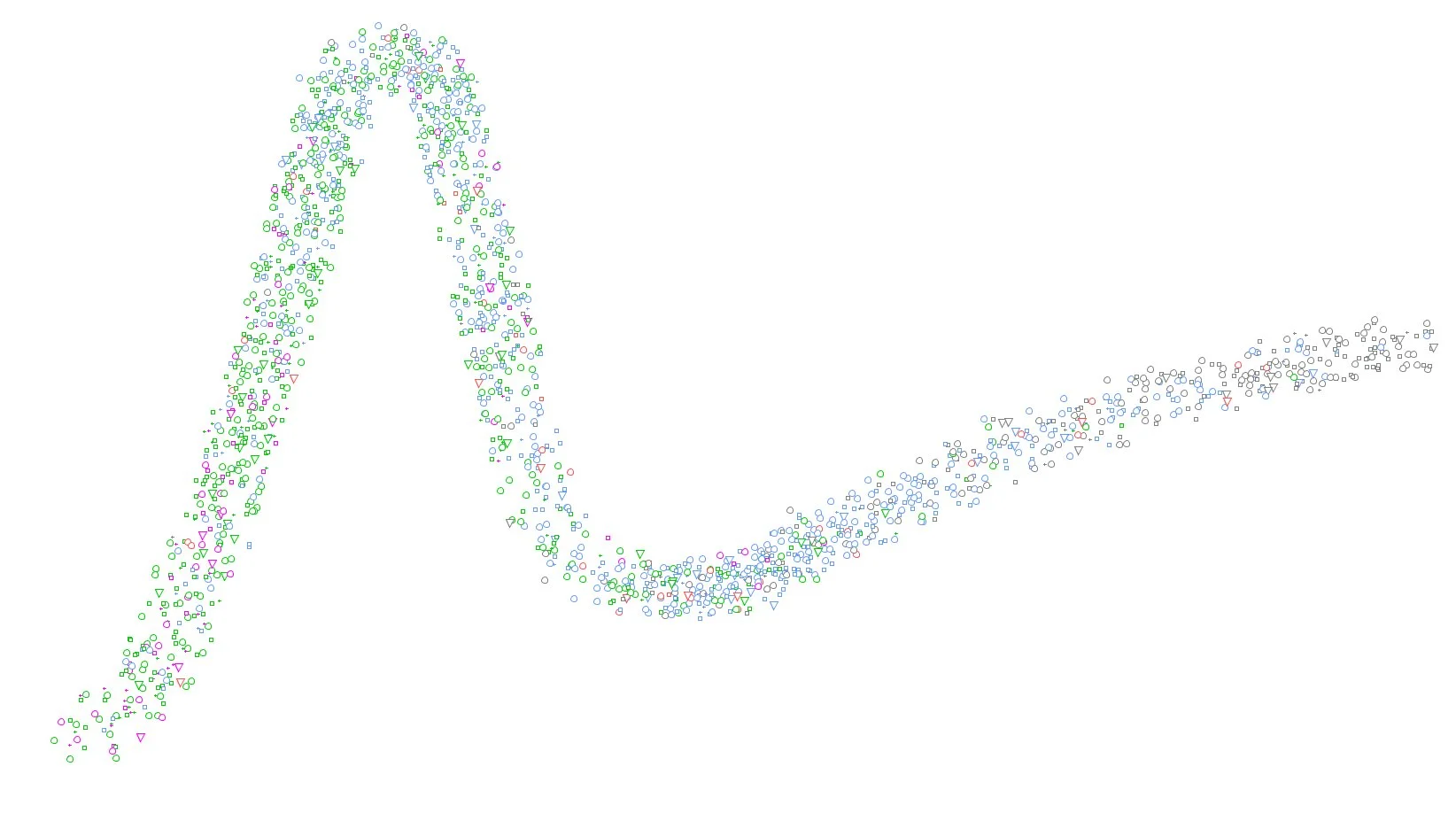Das Innovationsparadox: Warum erfolgreiche Unternehmen scheitern
Cisco dominierte jahrelang den Video-Konferenz-Markt mit WebEx. Dann kam 2020 – und ein unbekanntes Startup namens Zoom eroberte in wenigen Monaten die Welt. Wie konnte das passieren?
März 2020 veränderte die Arbeitswelt für immer. Millionen Menschen mussten plötzlich remote arbeiten. Cisco's WebEx war seit Jahren Marktführer bei Unternehmens-Video-Konferenzen, mit etablierten Kundenbeziehungen und ausgereifter Technologie. Trotzdem wurde Zoom zum Synonym für Video-Calls, während WebEx in der Versenkung verschwand.
Wie konnte ein kleineres Unternehmen wie Zoom den etablierten Marktführer so deutlich überholen? Diese Frage beschäftigt mich seit meinen ersten Jahren als Innovationsmanager. Warum scheitern die erfolgreichsten Unternehmen regelmäßig bei den wichtigsten Innovationen ihrer Branche?
Die Antwort liegt in einem fundamentalen Missverständnis darüber, was Innovation wirklich bedeutet.
Was Peter Drucker über Innovation wusste
Peter Drucker, einer der einflussreichsten Management-Denker des 20. Jahrhunderts, darf in keinem Text zu Innovation fehlen. Er formulierte die Rolle der Innovation so:
"Innovation ist das spezifische Instrument des Unternehmertums – der Akt, der Ressourcen eine neue Fähigkeit zur Schaffung von Wohlstand verleiht."
Der entscheidende Teil dieses Zitats ist "eine neue Fähigkeit". Nicht eine bessere Version des Bestehenden. Nicht eine Optimierung. Eine völlig neue Art, Wert zu schaffen. Cisco optimierte Enterprise-Video-Konferenzen und dachte in Kategorien wie "bessere Bildqualität" und "erweiterte Admin-Features". Zoom dachte anders: "Was, wenn Video-Calls so einfach wären wie ein Telefonat?" Zoom's Gründungsgeschichte zeigt diese Philosophie deutlich.
Das ist der Unterschied zwischen Verbesserung und Innovation.
Das Paradox im Detail
Seit vielen Jahren bin ich in der Rolle des Innovator oder Innovationstreibers aktiv – von Startup bis Konzern – und habe dabei immer wieder das Muster erkannt: je erfolgreicher ein Unternehmen ist, desto schlechter wird es bei radikaler Innovation. Das widerspricht allem, was wir über Business lernen. Erfolgreiche Unternehmen haben mehr Ressourcen für Forschung, besseren Zugang zu Talenten und etablierte Marktposition. Trotzdem werden sie regelmäßig von Newcomern überholt. Warum?
Das S-Kurven-Dilemma verstehen
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir ein fundamentales Prinzip des Innovationsmanagements verstehen: S-Kurven. Jede Technologie, jedes Geschäftsmodell folgt einer vorhersagbaren Entwicklung. Zunächst ein langsamer Start mit viel Aufwand und wenig Fortschritt, dann steiles Wachstum mit Durchbrüchen und Skalierung, schließlich Sättigung mit abnehmenden Erträgen trotz steigender Investitionen.
Das Problem liegt daran, dass etablierte Unternehmen ihre S-Kurve optimieren, während Disruptoren bereits die nächste S-Kurve parallel entwickeln. Wie Harvard Business Review erklärt, entstehen die erfolgreichsten Innovationen oft in Nischenmärkten, die für etablierte Player zunächst uninteressant erscheinen.
Ein faszinierendes Beispiel ist die Fleischindustrie. Unternehmen wie Tyson Foods perfektionierten jahrzehntelang Fleischproduktion – von Zucht über Verarbeitung bis zur Logistik. Währenddessen entwickelte Beyond Meat eine völlig neue S-Kurve: pflanzliche Proteine, die wie Fleisch schmecken. Beyond Meat's Börsenerfolg 2019 zeigte, dass sie eine neue Kategorie erschaffen hatten, während traditionelle Fleischproduzenten noch über Effizienzsteigerungen nachdachten. Eine beeindruckende Entwicklung und Ausbruch aus dem Dilemma zeigte das deutsche Unternehmen Rügenwalder Mühle, das sich als klassischer Fleischproduzent zum Marktführer bei veganen und vegetarischen Fleisch- und Wurstalternativen entwickelte.
Die drei Fallen des Erfolgs
Also, in welche Fallen laufen denn nun erfolgreiche Unternehmen, fragt man sich. Im Grunde sind es drei Themen:
Die erste Falle ist die Optimierungs-Spirale. Erfolgreiche Unternehmen werden zu Optimierungsmaschinen, die sich auf die Perfektion ihrer aktuellen S-Kurve konzentrieren, während die nächste bereits entsteht. Diese Fokussierung ist rational: Die bestehende Technologie liefert noch immer Verbesserungen, die Märkte sind etabliert, die Kompetenzen sind vorhanden. Die Falle liegt darin, dass wenn die aktuelle S-Kurve ihre Sättigungsgrenze erreicht, es oft zu spät ist, zur neuen zu wechseln.
Die zweite Falle ist die Kannibalisierungs-Angst. Echte Innovation bedroht meist das Kerngeschäft. Der Wechsel zu einer neuen S-Kurve bedeutet oft, profitable bestehende Geschäfte zu gefährden. Solange die alte S-Kurve noch Erträge generiert, scheint es unlogisch, sie aufzugeben. Doch genau diese Hesitation ermöglicht es Newcomern, die neue S-Kurve zu dominieren. Clayton Christensen nannte dies das "Innovator's Dilemma": Rational handelnde Manager treffen Entscheidungen, die langfristig zum Untergang führen.
Und die dritte Falle ist die Committee-Lähmung. Der Sprung zwischen S-Kurven erfordert Geschwindigkeit und Risikobereitschaft. Etablierte Strukturen sind aber auf Stabilität und Risikominimierung ausgelegt. Ein Beispiel aus meinen Projekten im Konzernumfeld illustriert dies: Wir wollten eine neue Technologie für die Produktentwicklung einsetzen. Technologie, Budget und Vision waren vorhanden. Doch der sechsmonatige Abstimmungsprozess zwischen vier Abteilungen kostete den entscheidenden Zeitvorsprung.
Die Design-Tool-Revolution als aktuelles Lehrstück
Ein weniger bekanntes, aber faszinierendes Beispiel ist die Design-Software-Revolution. Adobe dominierte jahrzehntelang mit Photoshop, Illustrator und InDesign. Ihre Tools waren ausgereift, professionell und Industriestandard. Dann kam Figma – ein kleines Startup aus San Francisco, das letzte Woche einen fulminanten Börsenstart hinlegte.
Adobe dachte in Kategorien traditioneller Software: bessere Features, mehr Präzision, erweiterte Funktionalität. Figma stellte eine andere Frage: "Was, wenn Design-Teams in Echtzeit zusammenarbeiten könnten, wie bei Google Docs?" Figma's Wachstum von 2016 bis 2022 war explosiv, weil sie kollaboratives Design ermöglichten, während Adobe noch in Desktop-Anwendungen dachte.
Das Ergebnis: Adobe war in 2022 bereit, 20 Milliarden Dollar für Figma zu zahlen – eine der größten Software-Übernahmen der Geschichte, wenn nicht Wettbewerbs-Bedenken aus Washington zum Rückzieher von Adobe Ende 2023 geführt hätten. Die Beinahe-Akquisition zeigt, wie disruptiv neue Denkweisen etablierte Märkte erschüttern können. Zum Börsenstart ist Figam rund 33 Milliard Dollar wert.
Was ich in der Bildungsbranche erlebe
In meiner aktuellen Rolle sehe ich das Innovationsparadox weiterhin. Traditionelle Bildungsanbieter haben alles: etablierte Marken, bewährte Inhalte, regulatorische Expertise. Trotzdem innovieren EdTech-Startups schneller. Das traditionelle Denken fragt: "Wie können wir unsere Lehrhefte digitalisieren?" Das innovative Denken fragt: "Wie könnten Menschen in Zukunft lernen?"
Ein interessantes Beispiel, an das man sich anlehnen kann, ist der E-Commerce-Bereich. Während SAP und Oracle jahrelang komplexe Enterprise-E-Commerce-Lösungen verkauften, baute Shopify eine völlig andere Vision: "Was, wenn jeder Mensch einfach einen Online-Shop erstellen könnte?" Shopify's Aufstieg zeigt, wie sie den Markt von unten aufrollten, während die etablierten Player noch über Enterprise-Features diskutierten. Es gibt also zahlreiche Beispiele, die zeigen, wie sich disruptives Denken und Handeln auszahlt und wie auf Bestehendes zu beharren sich eher zur Gefahr entwicken kann.
Die Lösung: Organisationale Ambidextrie als Betriebssystem
Eigentlich ist es ja einfach. Und ein Blick auf die S-Kurve zeigt was zu machen ist: erfolgreiche Innovation erfordert organisationale Ambidextrie – die Fähigkeit, gleichzeitig zwei verschiedene "Betriebssysteme" zu betreiben.
Das erste System fokussiert sich auf Exploitation – die Optimierung der aktuellen S-Kurve. Hier geht es um kurzfristige Ergebnisse, Effizienz und Qualität, bewährte Prozesse und Risikominimierung. Das bestehende Geschäft wird bedient und optimiert.
Das zweite System konzentriert sich auf Exploration – die Entwicklung der nächsten S-Kurve. Hier werden langfristige Wetten eingegangen, experimentiert und gelernt, neue Ansätze ausprobiert und Risiken kalkuliert eingegangen. Neue Märkte werden erschlossen.
Die Kunst liegt darin, beide Systeme parallel zu betreiben, ohne dass sie sich gegenseitig behindern oder kannibalisieren.
Der S-Kurven-Sprung: Von Alt zu Neu
Der Übergang zwischen S-Kurven folgt einem vorhersagbaren Muster. In der ersten Phase geht es um Sensing – schwache Signale erkennen. Technologische Trends werden beobachtet, Kundenbedürfnisse antizipiert, Startups und Forschung verfolgt.
Die zweite Phase ist Seizing – Chancen ergreifen. Prototypen werden entwickelt, Geschäftsmodelle getestet, Partnerschaften eingegangen. Ein gutes Beispiel ist Amazon's frühe Cloud-Investitionen, die parallel zum E-Commerce aufgebaut wurden.
Die dritte Phase bedeutet Transforming – die Organisation anpassen. Neue Strukturen werden geschaffen, Talente umverteilt, ein Kulturwandel vorangetrieben.
Praktische Strategien für den Wandel
Basierend auf meinen Erfahrungen bei Deutsche Bahn, verschiedenen Digitalagenturen und jetzt im EdTech-Bereich haben sich sechs Prinzipien bewährt.
Zunächst müssen geschützte Innovationsräume geschaffen werden. Das "Lab-Modell" ermöglicht separate Einheiten, die außerhalb der normalen Hierarchie operieren können, mit eigenen Budgets und KPIs, direktem Zugang zur Geschäftsführung und einer Experimentier-Kultur statt Optimierungs-Kultur. Bei der DB konnten unsere "d.Labs" und “Skydecks” schnell Prototypen entwickeln, während das Kerngeschäft weiter lief.
Portfolio-Management ist entscheidend. Die 70-20-10 Regel hat sich bewährt: 70% der Ressourcen fließen ins Kerngeschäft (Exploitation), 20% in angrenzende Innovationen und 10% in disruptive Experimente (Exploration). Wie Google diese Regel ursprünglich nutzte, zeigt sowohl die Möglichkeiten als auch die Herausforderungen dieses Ansatzes.
Intelligente Risiken müssen belohnt werden. Neue KPIs sollten eingeführt werden: Learnings pro Experiment, Speed-to-Market, Customer Problem Fit – nicht nur ROI und Effizienz messen. Ein gescheitertes Experiment ist kein Failure, sondern wertvolles Wissen für den nächsten Versuch.
Außerdem sind externe Antennen extrem wichtig. Corporate Venture Capital ermöglicht Investitionen in relevante Startups. Partnerships schaffen Kooperationen mit Technologie-Partnern. Advisory Boards bieten externe Experten als Frühwarnsystem. Gezielte Acquisitions bringen neue Kompetenzen ins Unternehmen.
Übergangsstrategien müssen entwickelt werden. Der "Bridge-Ansatz" nutzt bestehende Stärken als Brücke zur neuen S-Kurve. In der Bildungsbranche nutzen traditionelle Fernschulen ihre Content-Expertise und regulatorische Erfahrung, um KI-gestützte adaptive Lernplattformen und neue Formate zu entwickeln.
Die kulturelle Transformation ist das schwierigste Element. Menschen müssen bereit sein, ihre Expertise teilweise obsolet werden zu lassen. Erfolgreich gelingt das durch transparente Kommunikation über die Notwendigkeit des Wandels, Umschulung und Weiterbildung für bestehende Mitarbeiter und neue Karrierewege in innovativen Bereichen.
Das Timing-Problem lösen
Das größte Dilemma liegt allerdings oft im Timing: Wann ist der richtige Zeitpunkt für den S-Kurven-Sprung? Zu früh bedeutet, dass die neue Technologie noch nicht marktreif ist und hohe Verluste entstehen. Zu spät bedeutet, dass Konkurrenten bereits die neue S-Kurve dominieren. Die Lösung liegt in kontinuierlichen Experimenten, die gestartet werden, bevor sie notwendig werden. So lernt man die neue S-Kurve kennen, während die alte noch profitabel ist.
Die Zukunft gehört den Mutigen
2025 wird das Innovationsparadox noch deutlicher. KI, Quantencomputing, Biotechnologie – die nächste Innovationswelle rollt bereits an. Die Gewinner werden Unternehmen sein, die bereit sind, ihr Geschäftsmodell zu hinterfragen, Teams, die in Experimenten statt in Plänen denken, und Führungskräfte, die Unsicherheit als Chance begreifen.
Ein persönliches Beispiel an dieser Stelle: als ich 2014 bei der Deutschen Bahn VR-Technologie für die ICE-Produktentwicklung einführte, hielten mich viele für verrückt. "Das ist Spielkram", hieß es. "Wir bauen Züge, keine Videospiele." Heute nutzt der Konzern VR für Designprozesse und Schulungen von Mitarbeitenden. Die DB war Pionier – das wurde mir damas bereits auf meinen Vorträgen dazu überrascht widergespiegelt.
Diese Erfahrung lehrte mich: Innovation ist nicht nur eine technische Herausforderung. Es ist eine kulturelle und psychologische.
Der Weg nach vorn
Das Innovationsparadox ist nicht unüberwindbar. Aber es erfordert bewusste Entscheidungen. Werden Sie Kannibalisierung riskieren, um relevant zu bleiben? Werden Sie Ressourcen für Experimente ohne garantierten ROI bereitstellen? Werden Sie externe Bedrohungen als Inspiration statt als Feinde betrachten?
Diese Entscheidungen sind unbequem. Sie fordern etablierte Machtstrukturen heraus. Sie stellen Gewohnheiten in Frage. Aber sie sind notwendig.
Die wichtigste Erkenntnis: Erfolg macht nicht immun gegen Disruption – er macht anfälliger dafür. In einer Welt des permanenten Wandels ist die gefährlichste Strategie, an der Vergangenheit festzuhalten, die einen erfolgreich gemacht hat.
Wie siehst du das Innovationsparadox in deiner Branche? Welche etablierten Player wurden von Newcomern überrascht? Und wo siehst du die nächste Disruption kommen?